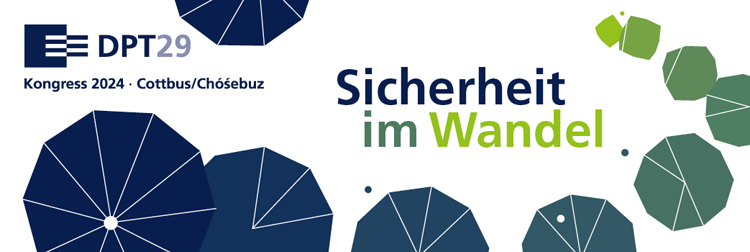Florian Rebmann
Universität Tübingen
Universität Tübingen
Abstract:
Aktuell wird in Deutschland unter Verweis auf die positiven Erfahrungen mit dem sogenannten „spanischen Modell“ der Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) zur Prävention eskalierender Partnerschaftsgewalt diskutiert. Im Fokus der Debatte stehen insbesondere Intimizide. Mehrere in der 20. Legislaturperiode eingebrachte Gesetzentwürfe, die die EAÜ im Gewaltschutzgesetz verankern sollten, fielen zuletzt der parlamentarischen Diskontinuität anheim. Im deutschsprachigen Raum fehlen indes bislang empirische Erkenntnisse darüber, inwieweit der Einsatz der EAÜ Intimizide tatsächlich verhindern kann. Auf Grundlage eines Samples von rund 100 Intimiziden, die sich überwiegend im Jahr 2017 ereigneten, wird untersucht, ob die EAÜ insoweit ein geeignetes Mittel ist. Die Untersuchung versteht sich als retrospektive Analyse. Es wird dabei anhand einer konkreten Operationalisierung geprüft, ob der Einsatz der EAÜ möglich und geeignet gewesen wäre, um die Taten zu verhindern. Nach einer kompakten Vorstellung des „spanischen Modells“ und einem Überblick über die dortige Studienlage werden die Ergebnisse der Potenzialanalyse präsentiert. Die Daten stammen aus dem Forschungsprojekt „Femizide in Deutschland“ des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen und des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.
Florian Rebmann

Florian Rebmann (*22.07.1996) ist akdemischer Mitarbeiter am Institut für Kriminologie (IfK) der Universität Tübingen. Nach Absolvierung des ersten juristischen Staatsexamens mit dem Schwerpunkt Kriminalwissenschaften im Jahr 2021 arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Kanzlei für Wirtschaftsstrafrecht. Seit 2022 forscht er am IfK zur Kriminologie der Tötungsdelikte mit einem Schwerpunkt auf Femizide und Tötungsdelikte in Partnerschaften. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören daneben die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und das deutsche Gewaltschutzrecht.