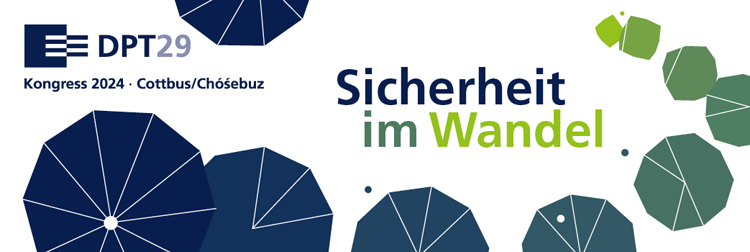Frederik Kohler
Universität Tübingen
Universität Tübingen
Abstract:
Die Coronapandemie war ein Lackmustest für die staatliche Durchsetzung neuer, erheblich in die Freiheiten der Bürger:innen eingreifender Regeln. Die Eindämmung der Coronainfektionen stand und fiel mit der Bereitschaft der Bürger:innen, sich an diese Regelungen zu halten. Gleichzeitig mussten Sicherheitsakteure wie die Polizei oder kommunale Ordnungsdienste ungewohnt stark in das tägliche Leben einer breiten Bevölkerung eingreifen und Verstöße ahnden. Eine Erklärung für die Bereitschaft, Gesetze einzuhalten und mit der Polizei zu kooperieren, bietet die Procedural Justice Theory (PJT). Demnach nehmen die Menschen die Polizei als legitim wahr und sind zur Einhaltung polizeilicher Anordnungen bereit, wenn sich die Polizei verfahrensgerecht verhält. Bislang ist aber weitgehend unerforscht, inwiefern dieser für den Normalfall gut belegte Zusammenhang auch in Krisen wie der Corona-Pandemie und auf andere Sicherheitsakteure wie kommunale Ordnungsdienste und private Sicherheitsdienste zutrifft. Im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts LegiNot erfolgte hierzu Anfang 2024 eine Online-Vignettenumfrage unter knapp 9.000 Befragten, die konkrete Kontrollsituationen bewerteten. Die Forschungsergebnisse zeigen das Potenzial aber auch die Grenzen von Verfahrensgerechtigkeit bei der Durchsetzung von Notfallmaßnahmen in langanhaltenden Krisen.
Frederik Kohler

Frederik Kohler ist Soziologe und Kriminologe und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Dort arbeitet er im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt LegiNot (Legitimation des Notfalls-Legitimationswandel im Notfall). Er promoviert im Fach Soziologie zu Vertrauen in Sicherheitsakteure in Krisenzeiten. Als Grundlage für seine Analyse dient ihm eine im Rahmen von LegiNot erfolgte Online-Vignettenumfrage unter knapp 9.000 Befragten.