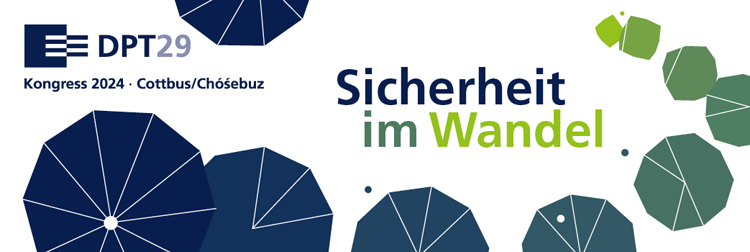Der Deutsche Präventionstag trauert um Prof. Dr. Dieter Rössner
Prof. Dr. Britta Bannenberg
Justus-Liebig-Universität Gießen
Am 16. April 2025 ist Dieter Rössner überraschend gestorben. Er hätte am 25. August 2025 seinen achtzigsten Geburtstag mit uns gefeiert und wir hatten noch so viel mit ihm vor.
Dieter Rössner war Kriminologe und Strafrechtler mit Herz & Seele, er stand für Themen, die über Jahrzehnte die kriminologische und strafrechtliche Diskussion und Praxis geprägt haben und in strafrechtliche Reformen eingeflossen sind (§ 46a StGB; §§ 45 Abs. 2 Satz 2 JGG; § 10 Abs. 1, Satz 3 Nr. 7 JGG; § 7 JGG; § 15 JGG; zahlreiche Vorschriften der StPO, von §§ 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 über § 155a und § 155b StPO bis hin zu den Regelungen der Privatklage (§§ 374 ff. StPO), der Nebenklage (§§ 395 ff. StPO) und des Adhäsionsverfahrens (§§ 403 ff. StPO). Die Opfer und Opferrechte lagen ihm ebenfalls am Herzen (§§ 406d ff. StPO)). Dieter Rössner war in einem positiven, konstruktiven und über für manche scheinbar festgefügten Grenzen des Strafrechts und des Sanktionenrechts hinaus ein Vordenker: Ihm lagen der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und die Wiedergutmachung als menschliches Prinzip am Herzen. Die konstruktive Reaktion nach Straftaten lag ihm näher als der „harte Gegenschlag“ oder die „Bekämpfung von Straftaten“.
Zahlreiche Publikationen und Mitherausgeberschaften von Kommentaren, Lehrbüchern und wissenschaftlichen Beiträgen zeigen seine wissenschaftliche Lebensleistung deutlich auf. Die Festschriftübergabe zu seinem 70. Geburtstag in Tübingen 2015 vereinte Wissenschaft und Freunde. Die Professur in Marburg als letzter wissenschaftlicher Station war die berufliche Heimat, Tübingen und das Schwabenland waren aber seine Herkunft, seine Erdung, seine Heimat. In allen Bezügen wirkte Dieter so, wie wir es als Herausgeber damals (2015) als Leitprinzip hervorgehoben haben: Über allem: Menschlichkeit. Dieter war ein hervorragender Wissenschaftler. Das, was Dieter auszeichnete, war aber nicht nur der kundige, über Grenzen denkende Wissenschaftler, der er immer war: Er war Mensch. Er war liebenswert. Er hielt sich von den Konflikten und Disputen unter Kollegen fern. Fachliche Dispute focht er aus. Da könnte mancher in hohen Positionen befindliche Politiker lernen: Man kann für Ideen einstehen und sie bewerben, ohne den anderen als Menschen abwerten zu müssen.
Er war durch die Idee, anders als mit Geld- oder Freiheitsstrafe auf Straftaten zu reagieren, bereits in den 1980er Jahren der Visionär, der die Straftat nicht nur als Straftat, also als Verstoß gegen das geschriebene Recht mit höchster Strafandrohung, verstand. Er sah oft den menschlichen Konflikt, die aus dem Ruder gelaufene Beziehungsstreitigkeit, die situativ von Emotionen überwältigte Handlungs- (bzw. Gewalt-)bereitschaft und das Aufeinandertreffen von emotionalisierten Menschen in einer spezifischen Situation und nicht per se die Straftat.
Je nachdem, welcher Schaden angerichtet wurde und mit welcher Intention, hielt er den TOA oder die Wiedergutmachung für den besseren Bewältigungsversuch gegenüber einem (Allgemeinen) Strafrecht, das nur die unpersönliche Geldstrafe (über 80 % der Fälle) und die Freiheitsstrafe (mit oder ohne Bewährung) kennt. Im Jugendstrafrecht gab und gibt es eine deutlich breitere Sanktionspalette. Aber vor dem 1. JGGÄndG 1990 war der TOA nicht eigens erwähnt. Metaphysische Überhöhungen der Strafzwecke waren Dieter immer ein Gräuel. Für ihn stand an erster Stelle, den menschlichen Konflikt auf vernünftige, konstruktive und zukunftsweisende Reaktion zu lösen, die im besten Falle Einsicht beim Täter und Zufriedenheit oder Genugtuung beim Opfer hinterlässt.
Die „Wiederherstellung des Rechtsfriedens“ im bestmöglichen Sinne. Dieter war sehr engagiert, aber nie naiv. Ohne den oder die bemühten Vermittlerinnen und Vermittler stellte er sich den TOA nicht vor. Es ging um den moderierten Ausgleichsversuch. Der TOA ist anders als die breiter aufzufassende Mediation im Strafrecht angesiedelt. Auch der strafrechtliche Rahmen mit seinen Möglichkeiten, aber auch Grenzen, bei den Uneinsichtigen, den Taktierenden, den von ihren Verteidigern veranlasst Taktierenden, setzen Grenzen für die „freiwillige“ Wiedergutmachung. In der denkbaren Anwendbarkeit von möglichen, auch „opferlosen“ Delikten, war Dieter Rössner weit denkend und kühn (kaum ein Delikt sah er zunächst pauschal als nicht wiedergutmachungsfähig an), aber er wusste natürlich um die Grenzen bei schweren Gewaltdelikten, bei Sexualdelikten, bei Drogenhandel und bei emotional kalten Tätern ohne Empathie, bei taktierendem Verhalten von Strafverteidigern und erkannte sehr wohl die Grenzen in manchen Deliktsfeldern.
Dieter Rössner beließ es nicht bei theoretischen Höhenflügen, sondern versuchte schon im ersten TOA-Projekt („Handschlag Reutlingen“) – die Kriminologie ist eine empirische Wissenschaft – die Erprobung der Idee in der Praxis des Jugendstrafrechts und kurze Zeit darauf auch des Erwachsenenstrafrechts. Durchaus erfolgreich, wie die weitere Entwicklung zeigt-
Es folgten Publikationen und Forschungsberichte.
Britta Bannenberg
Dieter Rössner war Kriminologe und Strafrechtler mit Herz & Seele, er stand für Themen, die über Jahrzehnte die kriminologische und strafrechtliche Diskussion und Praxis geprägt haben und in strafrechtliche Reformen eingeflossen sind (§ 46a StGB; §§ 45 Abs. 2 Satz 2 JGG; § 10 Abs. 1, Satz 3 Nr. 7 JGG; § 7 JGG; § 15 JGG; zahlreiche Vorschriften der StPO, von §§ 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 über § 155a und § 155b StPO bis hin zu den Regelungen der Privatklage (§§ 374 ff. StPO), der Nebenklage (§§ 395 ff. StPO) und des Adhäsionsverfahrens (§§ 403 ff. StPO). Die Opfer und Opferrechte lagen ihm ebenfalls am Herzen (§§ 406d ff. StPO)). Dieter Rössner war in einem positiven, konstruktiven und über für manche scheinbar festgefügten Grenzen des Strafrechts und des Sanktionenrechts hinaus ein Vordenker: Ihm lagen der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und die Wiedergutmachung als menschliches Prinzip am Herzen. Die konstruktive Reaktion nach Straftaten lag ihm näher als der „harte Gegenschlag“ oder die „Bekämpfung von Straftaten“.
Zahlreiche Publikationen und Mitherausgeberschaften von Kommentaren, Lehrbüchern und wissenschaftlichen Beiträgen zeigen seine wissenschaftliche Lebensleistung deutlich auf. Die Festschriftübergabe zu seinem 70. Geburtstag in Tübingen 2015 vereinte Wissenschaft und Freunde. Die Professur in Marburg als letzter wissenschaftlicher Station war die berufliche Heimat, Tübingen und das Schwabenland waren aber seine Herkunft, seine Erdung, seine Heimat. In allen Bezügen wirkte Dieter so, wie wir es als Herausgeber damals (2015) als Leitprinzip hervorgehoben haben: Über allem: Menschlichkeit. Dieter war ein hervorragender Wissenschaftler. Das, was Dieter auszeichnete, war aber nicht nur der kundige, über Grenzen denkende Wissenschaftler, der er immer war: Er war Mensch. Er war liebenswert. Er hielt sich von den Konflikten und Disputen unter Kollegen fern. Fachliche Dispute focht er aus. Da könnte mancher in hohen Positionen befindliche Politiker lernen: Man kann für Ideen einstehen und sie bewerben, ohne den anderen als Menschen abwerten zu müssen.
Er war durch die Idee, anders als mit Geld- oder Freiheitsstrafe auf Straftaten zu reagieren, bereits in den 1980er Jahren der Visionär, der die Straftat nicht nur als Straftat, also als Verstoß gegen das geschriebene Recht mit höchster Strafandrohung, verstand. Er sah oft den menschlichen Konflikt, die aus dem Ruder gelaufene Beziehungsstreitigkeit, die situativ von Emotionen überwältigte Handlungs- (bzw. Gewalt-)bereitschaft und das Aufeinandertreffen von emotionalisierten Menschen in einer spezifischen Situation und nicht per se die Straftat.
Je nachdem, welcher Schaden angerichtet wurde und mit welcher Intention, hielt er den TOA oder die Wiedergutmachung für den besseren Bewältigungsversuch gegenüber einem (Allgemeinen) Strafrecht, das nur die unpersönliche Geldstrafe (über 80 % der Fälle) und die Freiheitsstrafe (mit oder ohne Bewährung) kennt. Im Jugendstrafrecht gab und gibt es eine deutlich breitere Sanktionspalette. Aber vor dem 1. JGGÄndG 1990 war der TOA nicht eigens erwähnt. Metaphysische Überhöhungen der Strafzwecke waren Dieter immer ein Gräuel. Für ihn stand an erster Stelle, den menschlichen Konflikt auf vernünftige, konstruktive und zukunftsweisende Reaktion zu lösen, die im besten Falle Einsicht beim Täter und Zufriedenheit oder Genugtuung beim Opfer hinterlässt.
Die „Wiederherstellung des Rechtsfriedens“ im bestmöglichen Sinne. Dieter war sehr engagiert, aber nie naiv. Ohne den oder die bemühten Vermittlerinnen und Vermittler stellte er sich den TOA nicht vor. Es ging um den moderierten Ausgleichsversuch. Der TOA ist anders als die breiter aufzufassende Mediation im Strafrecht angesiedelt. Auch der strafrechtliche Rahmen mit seinen Möglichkeiten, aber auch Grenzen, bei den Uneinsichtigen, den Taktierenden, den von ihren Verteidigern veranlasst Taktierenden, setzen Grenzen für die „freiwillige“ Wiedergutmachung. In der denkbaren Anwendbarkeit von möglichen, auch „opferlosen“ Delikten, war Dieter Rössner weit denkend und kühn (kaum ein Delikt sah er zunächst pauschal als nicht wiedergutmachungsfähig an), aber er wusste natürlich um die Grenzen bei schweren Gewaltdelikten, bei Sexualdelikten, bei Drogenhandel und bei emotional kalten Tätern ohne Empathie, bei taktierendem Verhalten von Strafverteidigern und erkannte sehr wohl die Grenzen in manchen Deliktsfeldern.
Dieter Rössner beließ es nicht bei theoretischen Höhenflügen, sondern versuchte schon im ersten TOA-Projekt („Handschlag Reutlingen“) – die Kriminologie ist eine empirische Wissenschaft – die Erprobung der Idee in der Praxis des Jugendstrafrechts und kurze Zeit darauf auch des Erwachsenenstrafrechts. Durchaus erfolgreich, wie die weitere Entwicklung zeigt-
Es folgten Publikationen und Forschungsberichte.
Britta Bannenberg
| Nachruf (Deutsch, PDF) |