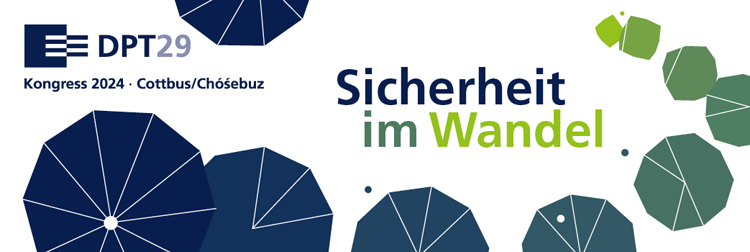Tägliche Präventions-News Nr.185 zum Themenkomplex Prävention in/nach Zeiten der Corona-Pandemie
Weitere News
zu dem Thema
Die COVID-19-Pandemie hat seit 2020 einen schrecklichen Tribut an Leben, Krankheit und wirtschaftlicher Verwüstung gefordert und hat vielfältige Auswirkungen auf Gewalt, Kriminalität und Prävention. Deshalb veröffentlichte die Tägliche Präventions-News wöchentlich aktuelle Informationen unter dem Label "Prävention in Zeiten der Corona-Virus-Pandemie". Seit Mai 2023 wird diese Rubrik zwar grundsätzlich insbesondere mit Hinweisen auf aktuelle Forschungsergebnisse fortgesetzt, jedoch nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus, sondern in unregelmäßigen Abständen.
Welche Folgen hinterlässt die Covid-19-Pandemie in der Arbeit von Polizeikräften?
Ein neues SOFI-Impulspapier behandelt pandemische Spuren in der Arbeit von Polizeikräften des Innendienstes. Der Diskussionsbeitrag von Sarah Herbst, Lena Schwerdt und Berthold Vogel geht insbesondere den arbeitsorganisatorischen Folgen der Coronapandemie nach und diskutiert empirische Befunde, wie digitalisierte Arbeitsabläufe, neue Kommunikationswege und die Einführung Mobilen Arbeitens die Arbeit von Polizeikräften verändert haben. Das Impulspapier geht aus dem Projekt „Soziologische Pandemiefolgenforschung am SOFI Göttingen“ hervor, das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) bis Ende 2024 gefördert wird. Ziel des Projekts ist die Analyse arbeitsweltlicher Nachwirkungen der Pandemie in verschiedenen Branchen. Eine davon ist der Bereich öffentlicher Sicherheit, in dem die Arbeit von Polizeikräften in den Blick genommen wurde.
Kommunale Resilienz stärken: Was wir aus dem kommunalen Krisenmanagement in der Coronapandemie für zukünftige Krisen lernen können
Die Pandemie hat als multidimensionale Dauerkrise Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht und Defizite im Krisenmanagement offenbart, dabei aber auch vielfach zu bemerkenswerten Anpassungen auf der lokalen Ebene geführt. Den Kommunalverwaltungen in Deutschland mangelte es seitdem jedoch an Zeit, Ressourcen und Strukturen, um die Erfahrungen und Innovationen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Dieser Beitrag beschreibt, wie das Projekt PanReflex Verwaltungsmitarbeitende ausgewählter Partnerkommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Reflexion des kommunalen Krisenmanagements in der Coronapandemie begleitet. Die Unterstützung des kommunalen Reflexionsprozesses mittels verschiedener Methoden der empirischen Sozialforschung und der anschließende Wissenstransfer zurück in die Praxis sollen dazu beitragen, die Resilienz der Kommunen gegenüber zukünftigen Krisen weiter zu stärken. Im Rahmen des Projektes werden der angesammelte Erfahrungsschatz gesichert und daraus verallgemeinerbare Erkenntnisse zur Stärkung der kommunalen Resilienz in Deutschland abgeleitet, langfristig nachgehalten und in die Breite getragen.
Wer will noch über Corona reden?
Eine ZEIT-Umfrage zeigt, wie groß das Interesse der Bürger an einer Aufarbeitung der Pandemie ist – und wie stark das Thema polarisiert. Sollte die Coronapandemie mit ihren Abstandsregeln, Bundesnotbremsen, Impfdebatten und Maskenpflichten in einem Bürgerdialog aufgearbeitet werden?
Quelle: Zeit-Online
Wie Long Covid Betroffene einschränkt
EPILOC-Studie untersucht mehr als 1500 ehemals Corona-Infizierte. Chronische Müdigkeit und Belastungsintoleranz, kognitive Beschwerden und eine erhebliche Einschränkung von Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität: Das sind die Befunde einer groß angelegten, baden-württembergischen Langzeitstudie über das Leiden nach einer Corona-Infektion. Für EPILOC (Epidemiologie von Long Covid) haben Forschende in den Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm mehr als 1500 ehemals Infizierte nachuntersucht und festgestellt: Zwei Drittel der am Post Covid-Syndrom leidenden Patientinnen und Patienten haben sich im zweiten Jahr ihrer Erkrankung kaum erholt. Trotz verschlechterter funktioneller Parameter zeigen Laboruntersuchungen beinahe keine pathologischen Befunde. Die Studienergebnisse sind jetzt im renommierten Journal PLOS Medicine erschienen.
Studie zu SARS-CoV-2: Handy- und Genomdaten erlauben gezielte Nachverfolgung von Infektionswegen
Um die Ausbreitung von Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 gezielter zu verfolgen, können anonymisierte Mobilfunkdaten und andere Metadaten (wie Postleitzahlen) mit Genomdaten kombiniert werden. Eine systematische Auswertung solcher kombinierten Datenpools wurde nun von Wissenschaftlern des Jenaer Startups nanozoo GmbH und des Universitätsklinikums Jena (UKJ) – beide Partner im InfectoGnostics Forschungscampus Jena – vorgestellt. Die Ergebnisse der Studie hat das Team unter dem Titel „Leveraging mobility data to analyze persistent SARS-CoV-2 mutations and inform targeted genomic surveillance“ im Open-Access-Journal eLife publiziert (DOI: 10.7554/eLife.94045.3).
Corona-Pandemie – und dann waren die Schulen zu
Die Schulschließungen haben junge Menschen stark getroffen. Wie wirkten sich diese auf das Thema Mobbing aus? PD Dr. Hendrik Sonnabend hat die Entwicklungen untersucht. Einmal hingefallen – und schon kursiert ein peinliches Video in der Whats-App-Gruppe einer Schulklasse. Mobbing findet nicht mehr nur persönlich in Form von Beleidigungen oder physischer Gewalt statt, sondern auch online. Es ist kein schönes Thema, allerdings tief in unserer Gesellschaft verwurzelt.
Beitrag zur Pandemieaufarbeitung
Über die Corona-Maßnahmen wurde viel diskutiert und mittlerweile zieht die Politik Bilanz: Welche waren berechtigt, welche würde man nicht mehr so beschließen? „Die Schulschließungen stehen immer noch in der Kritik und unsere Forschung kann einen Beitrag zur Pandemieaufarbeitung leisten“, sagt Hendrik Sonnabend. Die gemeinsame Untersuchung zeigt, dass Mobbing ein gesellschaftliches Problem ist, dass ernsthafte Aufmerksamkeit erfordert. Die Gründe, warum die Fälle von Cybermobbing zugenommen haben, sind vielfältig. Eine Erklärung könnte die mangelnde digitale Kompetenz in Schulen sein.
www.praeventionstag.de