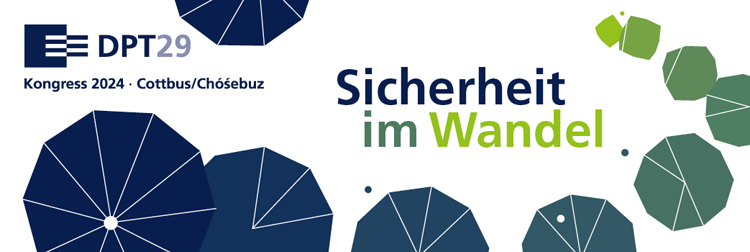Aktuelles aus dem Deutschen Bundestag
Weitere News
zu dem Thema
Verkauf und Nachnutzung ehemaliger KZ-Stätten
(hib/STO) Verkauf und Nachnutzung ehemaliger KZ-Stätten sind Thema der Antwort der Bundesregierung (20/14471) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13969). Danach liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, dass sich ein ehemaliges Außenlager des KZ Buchenwald in Leipzig seit dem Jahr 2009 im Eigentum eines Rechtsextremisten befindet. Wie die Bundesregierung weiter ausführt, ist bei der Nachnutzung ehemaliger KZ-Stätten durch Rechtsextremisten grundsätzlich davon auszugehen, „dass im Rahmen von rechtsextremistischen Veranstaltungen beziehungsweise anderweitiger Nutzung durch Rechtsextremisten das historische Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus eine Schändung erfahren oder ebenjenes verunmöglicht werden könnte“. Daher sei grundsätzlich „unter Ausschöpfung aller (rechtlichen) Möglichkeiten durch die beteiligten und zuständigen Stellen“ zu verhindern, dass eine Nutzung ehemaliger KZ-Stätten durch Rechtsextremisten erfolgen kann, heißt es in der Antwort weiter. Die Nachnutzung ehemaliger KZ-Stätten „sollte dem würdigen Gedenken der Opfer und der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen nicht widersprechen“. Dies sei im Einzelfall zu prüfen. Soweit bei Immobilien der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) Hinweise auf deren vormalige Nutzung im Zusammenhang mit Verbrechen des Nationalsozialismus bekannt sind, geht die BImA den Angaben zufolge bei der Verwertung dieser Liegenschaften behutsam vor und stimmt sich in sämtlichen Verkaufsvorhaben insbesondere mit den Kommunen, den Denkmalschutzbehörden sowie entsprechenden Stiftungen ab, um ethische und erinnerungspolitische Aspekte zu berücksichtigen. Da die BImA laut Vorlage entbehrliche Liegenschaften zuerst den Kommunen zum Erwerb anbietet, haben vor allem diese die Möglichkeit, „ortsbezogene historische Expertise einzubringen, Einfluss auf die Bewahrung der Gedenkstätten zu nehmen und Konzepte für den Umgang mit diesen Erinnerungsorten zu entwickeln“. Zudem werden in aller Regel Institutionen wie beispielsweise Gedenkstättenstiftungen, die sich um die Bewahrung der Erinnerung an die zeitgeschichtlichen Fakten und Hintergründe kümmern, in den Verwertungsprozess einbezogen, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. Danach achte die BImA bei der Käuferauswahl darauf, „dass keine Vertragsabschlüsse mit natürlichen oder juristischen Personen erfolgen, bei denen Anhaltspunkte auf deren Anhängerschaft zu extremistischen oder terroristischen Vereinigungen oder Organisationen mit Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder für sonstige kriminelle Handlungen vorliegen.
Politisch rechts motivierte Delikte in 2024 bis 30. November
(hib/STO) Im vergangenen Jahr sind mit Stichtag 30. November laut Bundesregierung insgesamt 33.963 Delikte der politisch rechts motivierten Kriminalität verzeichnet worden. Davon waren 1.136 Gewaltdelikte, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/14473) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14116) hervorgeht. Darunter befanden sich den Angaben zufolge fünf versuchte Tötungsdelikte, 988 Körperverletzungen, 17 Brandstiftungen und drei Sprengstoffdelikte.
Digitale Souveänität besonders wichtig
(hib/HLE) Die Bundesregierung hat die Bedeutung der technologischen und digitalen Souveränität Deutschlands betont. Diese Souveränität sei Leitmotiv der Digital- und Innovationspolitik der Bundesregierung und diene dem übergeordneten Ziel der strategischen Souveränität Europas, heißt es in der Antwort der Regierung (20/14418) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14101). Zur Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten gebe es unter anderem eine zielgerichtete Innovationsförderung und den Ausbau von Kompetenzen in Schlüsseltechnologien. Darüber hinaus hätten die strategischen Themen Cybersicherheit, Bekämpfung von Desinformation und Plattformregulierung besondere Priorität. Gegen Machtkonzentrationen in der digitalen Ökonomie gebe es verschiedene Regelungen wie das Gesetz über Digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA), erläutert die Bundesregierung. Der DMA unterwerfe besonders marktstarke Big-Tech-Unternehmen (sogenannte Gatekeeper oder Torwächter) klaren und strengen Regeln. So sehe der DMA beispielsweise Interoperabilitätsverpflichtungen vor und schreibe vor, dass die Bedingungen für eine Kündigung bestimmter Dienste nicht unverhältnismäßig sein dürften. Genannt werden von der Bundesregierung auch das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung. Damit sei es möglich, den Erwerb inländischer Unternehmen durch Unionsfremde zu prüfen, falls diese die Kontrolle über mindestens 25 Prozent der Stimmrechte an einem inländischen Unternehmen erwerben wollen. Gehöre das inländische Unternehmen zur Gruppe der Emerging Technologies wie Halbleiter, KI, 3D-Druck und Quantentechnologie, so betrage die Schwelle nur 20 Prozent.
Offene Haftbefehle gegen Personen des rechten Spektrums
(hib/STO) Zum Stichtag 30. September 2024 haben laut Bundesregierung bundesweit insgesamt 730 offene nationale, das heißt noch nicht vollstreckte Haftbefehle gegen 555 Personen bestanden, die dem politisch rechten Spektrum zuzurechnen sind. Hinzu komme ein Haftbefehl einer ausländischen Behörde zwecks Auslieferung, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14474) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14038). Danach lag insgesamt 27 Haftbefehlen ein politisch motiviertes Gewaltdelikt zugrunde, überwiegend Körperverletzungsdelikte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. 162 weitere Haftbefehle bestanden den Angaben zufolge wegen Straftaten mit politischer Motivation wie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung. Die übrigen Fälle sind laut Vorlage dem Bereich der Allgemeinkriminalität wie Diebstahl, Betrug, Erschleichen von Leistungen, Verkehrsdelikte und anderem zuzuordnen. In allen Fällen seien polizeiliche Fahndungsmaßnahmen initiiert worden.
Cyberangriffe auf Bundesbehörden in 2024
(hib/STO) Über Cyberangriffe auf deutsche Bundesbehörden berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14532) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (20/14372). Danach wurden im vergangenen Jahr vom Bundesamt in der Informationssicherheit (BSI) im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Dezember 80 gemeldete „IT-Sicherheitsvorfälle“ erfasst. 17 davon waren den Angaben zufolge erfolgreich und betrafen die Installation von Schadsoftware, die unautorisierte Systemnutzung sowie den Datenabfluss. Behörden müssen dem BSI laut Vorlage Cyberangriffe gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Meldeverfahren gemäß Paragraf 4 Absatz 6 des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) melden.
www.praeventionstag.de